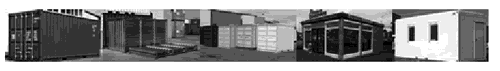
Seminar Wintersemester 05/06
Voraussetzungen/allgemein
Design ist unsichtbar. Mit Lucius Burckhardt fängt Design bereits vor der eigentlichen Gestaltung an: in den bautechnischen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, innerhalb derer eine Bauaufgabe verwirklicht wird. Sich auf die Suche nach dem Unsichtbaren des Designs begeben heißt: die Bedingungen der Möglichkeit einer bestimmten Architektur herausarbeiten, von den rechtlichen und politischen Vorgaben, über die in einer Zeit und an einem Ort verwendbaren Materialien und vorherrschenden Technologien, bis zu den Raum- und Wahrnehmungskonzepten.
Erzählungen der Box. Wenn wir den Container als eine Art Flucht- oder Endpunkt moderner Architektur in das Visier nehmen, soll es einerseits darum gehen, die Voraussetzungen herauszuarbeiten, unter denen der Container im Zuge des 20. Jahrhunderts zur „Architektur“ werden konnte; vor diesem Hintergrund soll die Frage gestellt werden, ob und wie sich eine architektonische Gestaltung des Containers entwickeln lässt: ist der Container überhaupt geeignet als Grundmodul von Gestaltung menschlichen Lebensraums? Andererseits geht es darum, die ikonischen oder piktogrammatischen Qualitäten des Containers zu erkennen und zu benennen. Es soll gefragt werden, was eine Containerarchitektur, in ihren verwendeten Materialien, in ihrer Objektqualität als Box und in ihren sichtbaren Elementen des technischen Transportsystems, aussagt: Welche Geschichten erzählt sie, welche Form von Sozialität inszeniert sie, welche Mythen transportiert sie, Gegenstand welcher Visionen ist sie? Die Ergebnisse dieser Untersuchungen der Semantiken des Containers könnten ebenfalls zum Ausgangspunkt neuer Gestaltungsentwürfe werden.
Literatur:
Burckhardt, Lucius, Design ist unsichtbar. In: Ders., Die Kinder fressen ihre Revolution, Köln 1985, S. 41-75
Ausstellungskatalog zu Parasite Paradise. A Manifesto for Temporary Architecture and Flexible Urbanism, 1. August - 28. September 2003, Leidsche Rijn, The Netherlands
Zugänge
Raumproportionen und ihre Normierung
Zu den zentralen Forderungen der architektonischen Moderne gehört die Normierung der gebauten Räume. Auch der weltweit verwendete ISO-Schiffscontainer ist Ergebnis eines umfassenden Standardisierungsprozesses, in dessen Mittelpunkt der für Transportzwecke verfügbare Rauminhalt des Behälters steht. Wenn solche Transportbehälter in der baulichen Gestaltung menschlicher Umwelten zum Einsatz kommen, besteht der entscheidende Unterschied zu normierten Räumen der modernen Architektur darin, dass das Maß der Container sich nicht nach menschlichen Größen ausrichtet, sondern sich ausschließlich nach den Erfordernissen der im Transportsystem beteiligten technischen Systeme organisiert(Straßenbreiten und -durchfahrtshöhen, Zuggrößen, Lademaschinen, erforderliche Belastbarkeiten für den Transport auf dem Schiff etc.).In welchem Verhältnis stehen logistisches und architektonisches „Zellen“maß? Wie verhalten sich diese Maße zu den tradierten Bedürfnissen nach Bewegungsmöglichkeiten und räumlicher Entfaltung einerseits und bestimmten Raumproportionalitäten andererseits?
Literatur:
Gropius, Walter, Normung und Wohnungsnot. In: Technik und Wirtschaft, 20. Jg. Heft 1/1927
Köstlin, Konrad, Das Mass aller Dinge. In: du Nr.733, 2003
Le Corbusier, Eine Zelle im menschlichen Maszstab. In: Ders., Feststellungen zu Architektur und Städtebau, Braunschweig/Wiesbaden 1987
Prigge, Walter (Hg.), Ernst Neufert. Normierte Baukultur im 20. Jahrhundert, Frankfurt/New York 1999
Smith, Courtenay/Topham, Sean, Xtreme Houses, München u.a. 2002, Introduction
Urban/Suburban
Typische Einsatzgebiete des Containers als Architektur sind:
(1) inner- oder randstädtische Peripherien; (2) Orte, an denen die Errichtung fester Architekturen nicht möglich oder nicht erlaubt ist (3) oder Orte, an denen aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder politischer Mehrheitsverhältnisse nur vorläufige Raumlösungen realisierbar sind. Immer häufiger entwickeln sich dabei Containerkonstruktionen, die als schnelle und vorübergehende Lösung errichtet wurden, dann jedoch zur dauerhaften Alternative für feste Bauwerke avancierten. Der Container scheint sich als Bestandteil innerstädtischer Architekturen zu etablieren. Die paradoxe Wirkung der Containerbauwerke besteht darin, dass sie in urbanem Sinne für Verdichtung zu sorgen (wie im Falle von Flüchtlingsheimen oder Bauarbeiterunterkünften) und städtischen Bedarf abzudecken (wie bei Universitätsräumen, ausgelagerten Ämtern, Geschäften, Banken, sozialen Einrichtungen, etc.). Zugleich jedoch wirken sie als Agenten einer weiteren Auflösung der Städte: Ihnen haftet als in kürzester Zeit zu entfernenden Gegenständen des Transports das Temporäre und Periphere an. Zu fragen wäre, ob es sich bei den immer weiter verbreiteten Containerarchitekturen tatsächlich nur um Exponenten einer bereits vielfach diagnostizierten Suburbanisierung und Auflösung der klassischen Stadt handelt oder ob sie auch als Zeugen einer neuen Form von Urbanität interpretiert werden können. Wie könnten Gestaltungen temporärer Lokalisierung aussehen, die mehr sind als bloßes Kaschieren der technischen Form?
Literatur:
Prigge, Walter, Vier Fragen zur Auflösung der Städte. In: Ders. (Hg.), Peripherie ist überall, Frankfurt/M und New York 1998
Sieverts, Thomas, Zwischenstadt: zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land, Vieweg 1997
Baccini, Peter/Oswald, Franz, Netzstadt. Einführung in das Stadtentwerfen, Basel 2003
Briggs Port-A-Fold Ltd. + Pro/Con Package Homes. In: Smith, Courtenay / Topham, Sean (Hg.), Xtreme Houses, München u.a. 2002
Mobilisierung des Architekturbegriffs
„Architektur“ bezeichnet im Griechischen den obersten Baumeister (griech. architekton) oder in anderen Auslegungen das erste Handwerk bzw. die erste Kunst. Wir gehen hier davon aus, dass die Kunst des Planens und Konstruierens im Sinne des Aufbauens zusammengesetzter Strukturen gemeint ist (griech. tekton – Erzeuger, Künstler, Verfertiger, Zimmermann). Im Zuge des Industriellen Bauens hat im 20. Jahrhundert der Herstellungsprozess als gestaltgebende Komponente an Bedeutung gewonnen. Heute ist der Architekturbegriff aus dem traditionellen Baubereich als strukturelle Metapher in andere Bereiche übernommen worden. Beispielhaft steht hier ein Bereich, in dem sich das Materielle und Feste zugunsten von Prozessualität aufgelöst hat: Als „Rechnerarchitektur“ und „Informationsarchitektur“ wird sie zum Modell dynamischer Systeme. Die seit einigen Jahren virulente Attraktivität des „universalen Transportbehälters“, des Containers, könnte darauf hindeuten, dass sich dieser mobilisierte Begriff von Architektur als Abbild von Prozessen auf das eigentliche Feld der Architektur rücküberträgt. In einer Welt „intelligenter Gebäude“ könnte der Container, als architektonisches Element eines weltweit vernetzten technischen Systems, zum Leitmedium einer neuen Ästhetik des Prozessualen werden. Wie könnte eine solche Ästhetik „dauerhafter Vorläufigkeit“ aussehen? Wie verhält sich die nach wie vor massive Materialität auch des containerbasierten Bauens zu den „leichtfüßigen“ Begriffen von Vernetzung und Virtualität?
Literatur:
Baudrillard, Jean, Der Beaubourg-Effekt. Implosion und Dissuasion. In: Ders., Kool Killer oder Der Aufstand der Zeichen, Berlin 1978
Flusser, Vilém, Vom Unterworfenen zum Entwerfer von Gewohntem (Referat zum 1. Symposium „Intelligent Building“, Universität Karlsruhe, Oktober 1989). In: Arch+, März 1992
Kittler, Friedrich, Die Stadt ist ein Medium. In: Fuchs, Gotthard u.a. (Hg.), Mythos Metropole, Frankfurt/Main 1995
Scoates, Christopher (ed.), Lot-ek: Mobile Dwelling Unit, New York 2003
Das Atmosphärische
Zur Wahrnehmung und Erschließung eines Raumes ist die Raumatmosphäre von entscheidender Bedeutung. Welche Parameter spielen hierbei eine Rolle? Licht, Klang, Material, Proportion, das kinästhetische Zusammenspiel aller dieser Sinneseindrücke, geschichtliche Metaphern, erzählerische und szenische Zusammenhänge prägen das subjektive Verhältnis zu einem Ort und zum Raum. Der Container als Behauptung von Architektur, als „piktogrammatisches Haus“ und technische Bereitstellung von Lagerraum, gibt sich hermetisch und unheimlich: Seine Uniformität, seine Allgegenwart und seine universelle Einsetzbarkeit lassen ihn als das absolute Gegenteil von erfüllter architektonischer Räumlichkeit erscheinen. Gibt es gestalterische Elemente, etwa „Erzählungen des Containers“, spezifische materiale oder räumliche Qualitäten der Stahlkiste, die als mögliche Entwurfsparameter in die Raumgestaltung des Containers einfließen können und ihn zu einem architektonischen Raum entwickeln?
Literatur:
Heidegger, Martin, Bauen, Wohnen, Denken. In: Ders., Vorträge und Aufsätze Teil 2, Pfullingen 1967
Sloterdijk, Peter, Sphären 3. Schäume. Plurale Sphärologie, Frankfurt/Main 2004
Valena, Tomás, Beziehungen. Über den Ortsbezug in der Architektur, Berlin 1994
Dozenten:
Entwerfen: Gesa Mueller von der Haegen
Kunst- und Medienwissenschaft: Alexander Klose
Architekturtheorie/geschichte: NN
Raumabbildung/Fotografie: Stefan Baumann
Gesa Mueller von der Haegen
Professur für Temporäre Architektur und Urbanistik
Staatliche Hochschule für Gestaltung Lorenzstrasse 15
D – 76135 Karlsruhe
Sekretariat: Elvira Heise +49 721 8203 2338